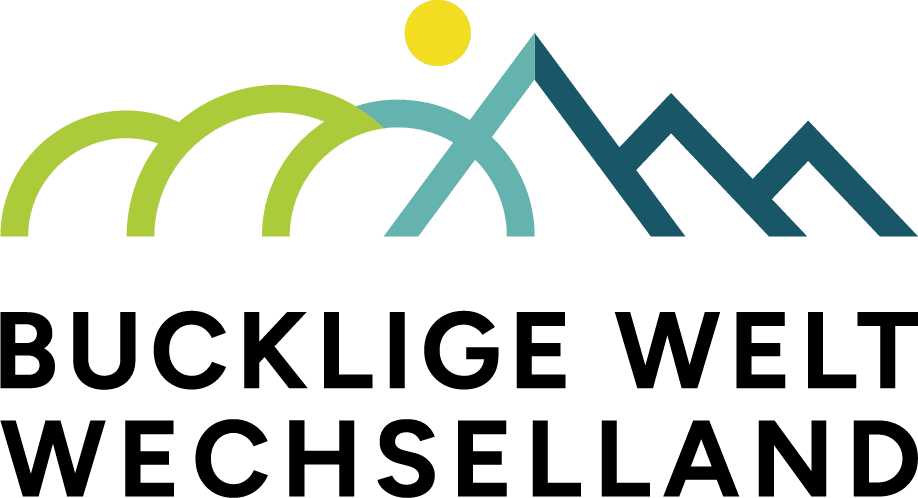Die Wohnhausanlage in der heutigen Gymelsdorfergasse erinnert nicht mehr an eines der dunkelsten Kapitel der Stadtgeschichte. Bei historischen Stadtspaziergängen wird aber daran erinnert / Fotos: Marcus Steppan, Schwendenwein
Vergessene Spuren: es gibt keine Gedenktafel. Keinen Stolperstein. Nur eine unscheinbare Wohnhausanlage. Und doch erinnert die Gasse an der Wiener Neustädter Stadteinfahrt an eines der dunkelsten Kapitel der Stadthistorie: das „Judenlager“ von Wiener Neustadt.
Im Sommer 1944 brachten die Nationalsozialisten mehr als 200 jüdische Frauen, Männer und Kinder aus Ungarn in ein Arbeitslager. Sie mussten Schutt räumen, Trümmer schleppen, unter Hunger und Gewalt überleben. Für viele war es nur eine Zwischenstation auf dem Weg in den Tod. Wenn am 8. Mai europaweit der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht wird, wird auch ihrer gedacht – selbst wenn man ihre Namen vielfach nicht kennt.
Keine Schuld, aber Verantwortung
„Über lange Zeit war es die sogenannte „Schuldfrage“ – also die Frage, wer die Schuld an den Ereignissen der NS-Zeit tragen würde –, die dazu geführt hat, zu verdrängen und zu (ver-)schweigen“, erklärt der Wiener Neustädter Historiker Werner Sulzgruber. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten intensiv die jüdische Geschichte Wiener Neustadts und der gesamten Region erforscht und in Erinnerung gerufen. Er meint: „Ausgesprochen wichtig ist es zu betonen, dass wir als nachfolgende Generationen keine Schuld an den Verbrechen der NS-Zeit haben, aber eine gewisse Verantwortung tragen, über diesen Teil der Geschichte Bescheid zu wissen und ihn in Erinnerung zu halten“ Diese Verantwortung beginnt lokal. Gerade deswegen erinnert Sulzgruber auch an das ehemalige „Judenlager“, dessen Geschichte jahrzehntelang verdrängt wurde und daher Gefahr läuft in Vergessenheit zu geraden.
Hunger, Krankheit, Tod
Die Insassen mussten zwölf Stunden am Tag arbeiten – trotz Krankheit, Hunger und Gewalt. Kinder galten ab 13 als „arbeitsfähig“, Schwangere gebaren ihre Kinder im Lager. Für Erkrankte gab es keine Gesundheitsversorgung im Sinne der Menschlichkeit, behandelt wurde nur, was als zweckmäßig betrachtet wurde. Die Menschen sollten arbeitsfähig bleiben, nicht aber gesund werden. Wer an den Folgen von Ausbeutung und Missbrauch starb, wurde in einem Massengrab verscharrt. Im Frühjahr 1945 wurde das Lager „evakuiert“ – ein zynischer Begriff für einen Todesmarsch in Richtung KZ Mauthausen.
Warum ist dieser Teil der Geschichte heute kaum bekannt? Sulzgruber erklärt: „Wir leben in einer Informationsgesellschaft, in der Menschen so sehr mit dem Hier und Jetzt beschäftigt sind, dass Dekaden Zurückliegendes seinen Stellenwert verliert.“ Umso wichtiger sei es, die für die Gesellschaft bedeutsamen historischen Sachverhalte zu erkennen und zu bewahren.
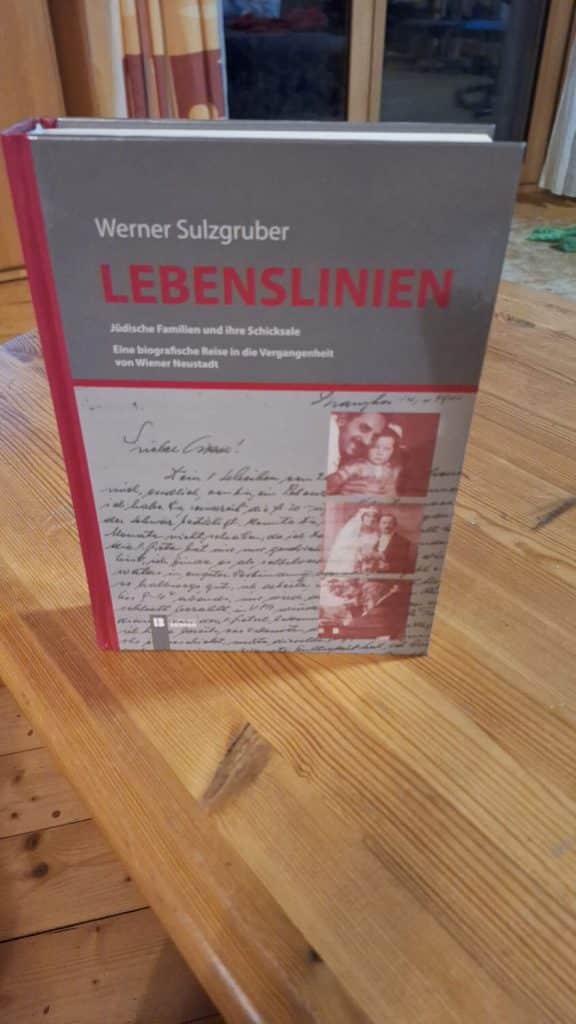
Werner Sulzgruber hat die jüdische Geschichte der Region in zahlreichen Projekten erforscht – unter anderem auch in „Lebenslinien“.
Geschichte bewahren, Zukunft gestalten
Sulzgruber betont: „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Gestaltung der Zukunft und ihre Entwicklungen untrennbar mit der Vergangenheit verbunden sind. Kennt man das Vergangene, dann kann man Vorgänge der Gegenwart und künftig zu Erwartendes entsprechend fundiert bewerten und gezielt ansteuern – oder aber Bestimmtes verhindern.“
Kulturelles Gedächtnis
Gerade in Wiener Neustadt, einer Stadt, die 1945 zu den zerstörtesten Europas zählte, einer Stadt mit industrieller Vergangenheit und eben auch reicher jüdischer Geschichte, liegt es nahe, die Erinnerung wachzuhalten – nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern als Teil des kulturellen Gedächtnisses. „Wenn man das Vergangene nicht kennt, wird man gezwungen sein, jede Erfahrung immer wieder neu zu machen“, mahnt der Historiker. Es sei daher unsere Aufgabe, nicht zu verdrängen – sondern sichtbar zu machen, was war. Nur so könne man begreifen, wie leicht Gesellschaften kippen können, wenn Hass und Ausgrenzung toleriert werden.
Das „Judenlager“ ist verschwunden. Aber seine Geschichte bleibt – wenn man bereit ist, hinzusehen.
Das „Judenlager“ von Wiener Neustadt
- Errichtet im Sommer 1944 in Wiener Neustadt, südlich der Richtergasse
- Rund 230 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter:innen – darunter viele Frauen und Kinder
- Einsatz bei Schutt- und Räumarbeiten nach Bombenangriffen
- Bewacht von der SS, schlechte hygienische und medizinische Bedingungen
- Todesfälle, Geburten und Erkrankungen dokumentiert
- Evakuiert im März 1945 – Fußmarsch Richtung KZ Mauthausen („Todesmarsch“)
- Heute kaum noch Spuren davon im Stadtbild sichtbar
- www.judenlager-wiener-neustadt.at